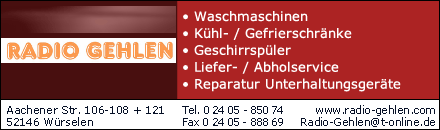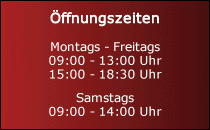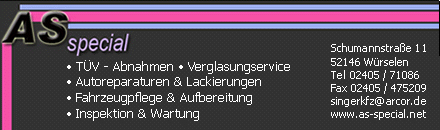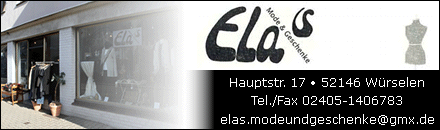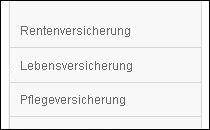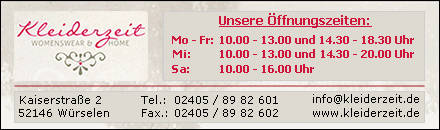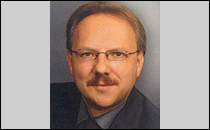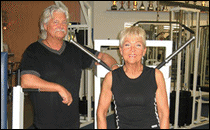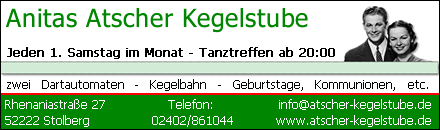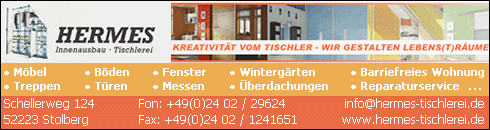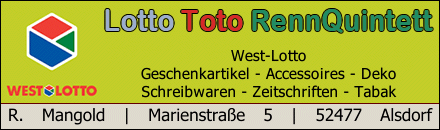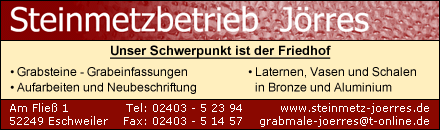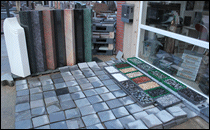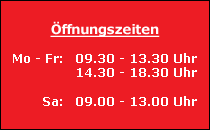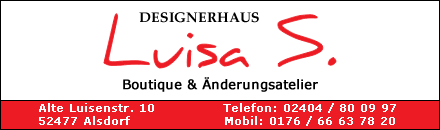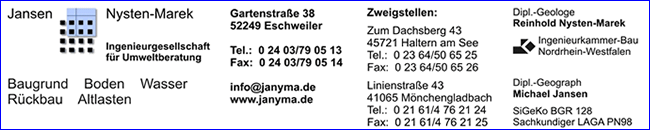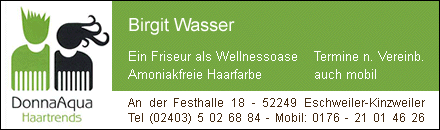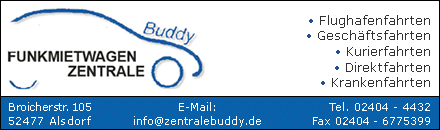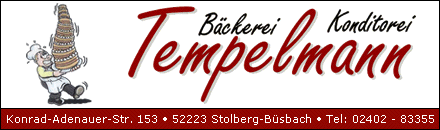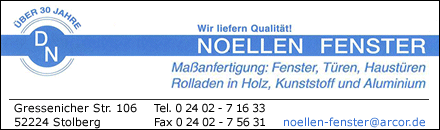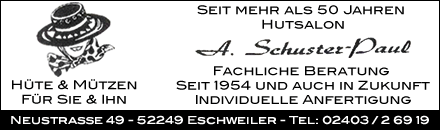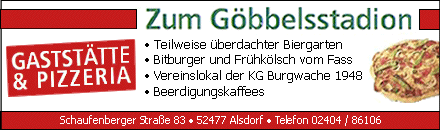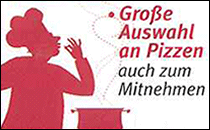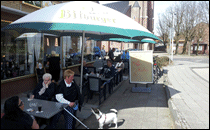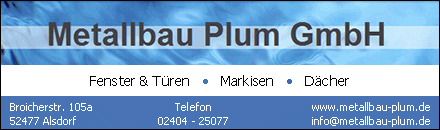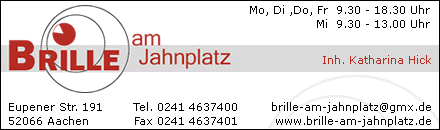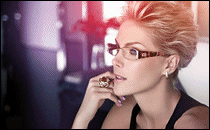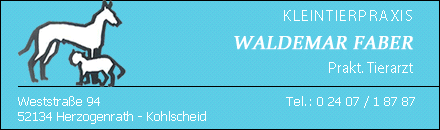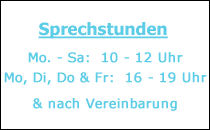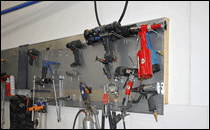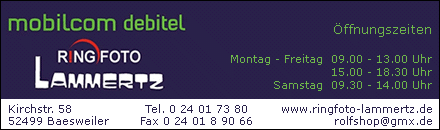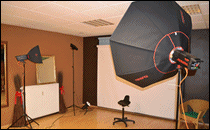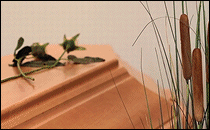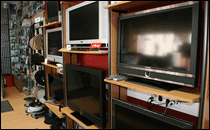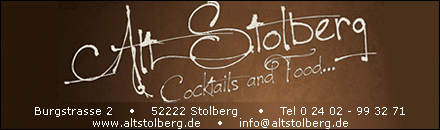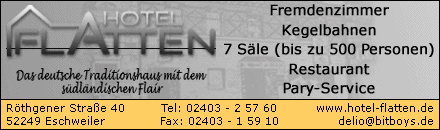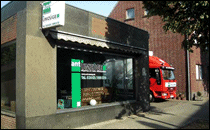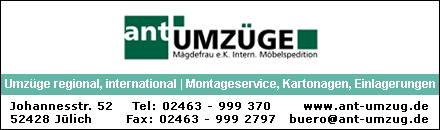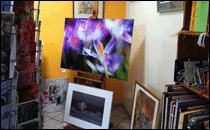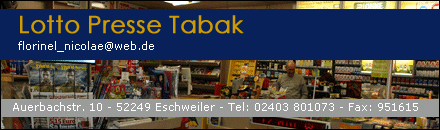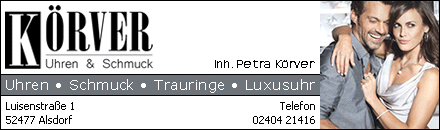|
Die Stadt Würselen (auch als Stadt der Jungenspiele bekannt) ist eine mittlere regionsangehörige Stadt in der nordrhein-westfälischen Städteregion Aachen. Würselen ist Sitz von Behörden der Städteregion Aachen und mehrerer großer Unternehmen.
Stadtgliederung Im Zuge der Gebietsreform in Nordrhein-Westfalen und des mit diesem in Zusammenhang stehenden Aachen-Gesetzes wurde das Gebiet der damaligen Stadt Würselen 1972 um weite Teile der bis dahin selbständigen Gemeinden Bardenberg und Broichweiden erweitert. Seitdem besteht Würselen aus den Ortsteilen: Bardenberg, Broichweiden und Würselen Diese untergliedern sich wiederum in folgende Ortsteile: Würselen: Bissen Dobach Elchenrath Grevenberg Markt-Preck Morsbach Oppen-Haal Scherberg Schweilbach Teut-Siedlung Broichweiden: Broich Euchen Linden-Neusen St. Jobs Vorweiden Weiden Wersch Bardenberg: Pley Bardenberg Geschichte Im Jahr 870 wurde Würselen zum ersten Mal unter dem Namen Uuormsalt im goldenen Buch der Abtei Prüm urkundlich erwähnt. Um 1100 gehört Würselen zum so genannten Aachener Reich. Von 1265 bis 1269 erbaute Graf Wilhelm IV. von Jülich auf den Resten einer älteren Feste die nach ihm benannte Burg Wilhelmstein. Sie wurde aber erst im Jahr 1344 schriftlich erwähnt.
Von 1336 bis 1798 war Würselen ein Quartier der Reichsstadt Aachen. 1616 tauchte Würselen urkundlich als Wurseln auf, im selben Jahr dann als Würselen. Von 1794 bis 1815 gehörten große Teile von Würselen (Bardenberg, Broich, Duffesheide, Euchen, Linden Neusen, Vorweiden) zum französischen Kanton Eschweiler im Département de la Roer, seit 1815 zum Kreis Aachen. Würselen-Mitte war die Mairie Würselen. 1924 hatte Würselen ungefähr 14.600 Einwohner und erhielt die Stadtrechte. 1944, zum Ende des Zweiten Weltkrieges, erlebte Würselen eine schwere Bombardierung durch die US-Amerikaner. Dabei wurden fast alle Gebäude zerstört. Während der Schlacht um Aachen war Würselen für sechs Wochen Hauptkampflinie, bis die US-Amerikaner am 18. November den Rest von Würselen einnahmen. Damit schlossen die Amerikaner den Ring um Aachen; drei Tage später fiel Aachen. Jahrhundertelang hatte der Abbau von Steinkohle das Wirtschaftsleben in Würselen bestimmt, da einige Gruben des sog. Aachener Revieres im westlichen Bereich des heutigen Stadtgebietes liegen: Im Wurmtal befanden sich die Gruben Alte Furth, Gouley und Teut. Aufgrund der hohen Gefährdung der Bergleute bei ihrer Arbeit entwickelte sich auch in Würselen im 19. Jahrhundert das Knappschaftswesen - in dieser Zeit wurde das Knappschaftskrankenhaus in Bardenberg gegründet. 1969 ging die Epoche der Kohleförderung mit der Schließung der Grube Gouley, die zu den ältesten Gruben des Aachener Revieres gehört hatte, zu Ende.
Am 1. Januar 1972 wurden bei der kommunalen Neugliederung die Gemeinden Bardenberg und Broichweiden mit Würselen zusammengeschlossen. Damit stieg die Zahl der Einwohner auf rund 34.500. Herleitung des Städtenamens Die erste Namensgebung Wormsalt oder Uuormsalt setzt sich aus dem altgermanischen Adjektiv warm für warm und dem Substantiv sal für Saal, Kirche oder Hof zusammen. Hierbei bezeichnet sal einen Salhof, also einen karolingischen Nebenhof der Aachener Kaiserpfalz, der in erster Linie der Verwaltung der verstreuten Ländereien und der Versorgung des Haupthofes diente. Als Standort des Salhofes und der dazugehörigen Kirche wird das Gelände der Würselener Hauptkirche St. Sebastian angenommen. Das Adjektiv warm bezieht sich auf den nahen Grenzbach Wurm, der aus den warmen Quellen Aachens gespeist wird. Der Begriff findet sich auch in späteren Erwähnungen als Quartier over Worm, also die Region jenseits der Wurm, wieder. Der zweite Salhof der Aachener Pfalz mit eigenständiger Kirche wird gemeinhin in Laurensberg angenommen. Partnerstädte Die Stadt Würselen pflegt Städtepartnerschaften mit:
Darüber hinaus wird an einer weiteren Partnerschaft mit dem englischen Colchester gearbeitet. Kultur Die Stadt bietet ein breit angelegtes Kulturprogramm. Auf Burg Wilhelmstein findet jährlich auch ein überregional bedeutendes, internationales Open-Air-Programm mit Musik- Kleinkunst- und Kabarettveranstaltungen statt. Neben zahlreichen kulturellen Initiativen (wie dem Kulturforum Würselen) bieten auch die Kleinkunstreihen im Kulturzentrum „Altes Rathaus“ sowie das von Christoph Leisten initiierte Literaturfestival Tage der Poesie alljährlich überregional bedeutsame Veranstaltungen. Im Alten Rathaus befindet sich auch die Stadtbücherei Würselens. Kulturelle Besonderheit in Würselen sind die Jungenspiele. Wirtschaft und Infrastruktur In Würselen liegt das Gewerbegebiet Kaninsberg/Aachener Kreuz.
Weitere bedeutende Unternehmen sind Kronenbrot, Metro Cash & Carry, die Sahinler Group, die Offergeld Logistik und die „Größte Wanduhren- und Standuhrenausstellung der Welt“ betrieben von Uhrmachermeister Kriescher. Unweit davon, direkt neben der Post betreibt die Familie Dieter Breuer ihren Laden, der durch fast 3000 Biersorten und 300 Mineralwässer 10 Jahre lang ins Guinness-Buch der Rekorde gelangte und seitdem ins „EU-Who-is-who“. Verkehr In Würselen liegt der Flugplatz Merzbrück, das Gewerbegebiet „Aachener Kreuz“ (Kaninsberg) und das Straßenverkehrsamt für Kreis Aachen und Stadt Aachen. Neben der engen Einbindung in das regionale Radwegenetz in NRW führt die Wasserburgen-Route durch die Stadt. Sie verbindet über 524 km mehr als 130 Burgen am Rand der Eifel und in der Kölner Bucht.
Bundesstraßen und Autobahnen Die Bundesstraßen 57 und 264 durchziehen Würselen und Broichweiden. Würselen ist von drei Autobahnanschlüssen aus zu erreichen.
Stadtbusse Die Stadtbuslinie WÜ1 bedient von Kohlscheid-Bahnhof kommend Würselen (Parkhotel – AQUANA – Gewerbegebiet – Euchen). Würselen wird auch von mehreren wichtigen Regionalbuslinien bedient, die in der Regel mit Gelenkbussen fahren:
Die heutigen Buslinien 11 und 21 ersetzen die etwa auf dem gleichen Linienweg und mit den gleichen Liniennummern verkehrenden Straßenbahnlinien der Aachener Straßenbahn. Bahngeschichte Würselen hatte einen Bahnhof und den Haltepunkt Würselen Mitte. Im Bahnhof Würselen kreuzten sich früher die Bahnstrecke Kohlscheid–Stolberg und die Bahnstrecke Aachen Nord–Jülich. Die Gleisanlagen am Bahnhof waren sehr vielfältig und Würselen hatte neben einem Empfangsgebäude ein Bahnbetriebswerk und zwei Stellwerke. Der Haltepunkt Würselen Mitte lag im Bereich Markt/Kaiserstraße und existiert heute nicht mehr. Er besaß ein Wartehäuschen. An seiner Stelle befindet sich heute ein Parkplatz. Nach dem Abriss der Bahnanlagen in den 1980er und 1990er Jahren wurde das Bahnhofsgelände mit einer Umgehungsstraße, dem Willy-Brandt-Ring, überbaut. Auf dem ehemaligen Gelände des Bahnbetriebswerks befinden sich heute eine Turnhalle sowie ein Sportplatz. Das vormalige Empfangsgebäude wird heute als Jugendzentrum und als Kino genutzt; beide Einrichtungen werden von einem unabhängigen Verein betrieben Bildung
Berufsschulen und das Berufskolleg befinden sich in den Nachbarstädten Aachen, Alsdorf, Eschweiler und Herzogenrath. Gesundheit In Würselen liegt das Medizinische Zentrum der StädteRegion Aachen. Banken Würselen ist Sitz der VR-Bank Würselen eG. Medien Radio Alaaf, mit Sitz in Würselen, wird seit 10 Jahren betrieben. Radio Alaaf sendete bis 2003 auf UKW 97,7 MHz, seit 2009 wieder während der 5. Jahreszeit (vom 07.01. bis Aschermittwoch) per Internet für die Städteregion Aachen. Der 1837 entstandene Stollen dient ursprünglich der Förderung und zuletzt der Wasserhaltung der Grube. In Würselen selbst halten die „Gouleystraße“ und der „Gouleypark“ die Erinnerung an die Grube wach. Inzwischen wird untersucht, ob die Grubenwässer der stillgelegten Gruben des Aachener Reviers zur Erdwärmegewinnung genutzt werden können. Einbezogen ist dabei auch der alte Förderschacht von Gouley.Bardenberg ist eine Ortschaft im westlichen Nordrhein-Westfalen und gehört seit 1972 zu Würselen im Kreis Aachen. Nachbarorte sind Würselen-Morsbach, Alsdorf-Duffesheide, Herzogenrath-Niederbardenberg und Herzogenrath-Kohlscheid. Nach Westen hin wird die Breite des Brückenkopfes durch zwei Halbbastionen und eine Vollbastion gegliedert. Im Gegensatz zu den Bastionen der Zitadelle und der Stadtbefestigung aus dem 16. Jahrhundert, die sämtlich Vollbastionen (vollständig mit Erdreich gefüllt) sind, handelt es sich bei den Bastionen des Kronwerkes um leere Bastionen, die über keine Füllung verfügen.
Bardenberg liegt auf einer Anhöhe nordwestlich vom Würselener Stadtzentrum östlich der Wurm. Das einstige Knappschaftskrankenhaus Bardenberg fusionierte 2001 mit dem Würselener Krankenhaus zum "Medizinisches Zentrum Kreis Aachen“ und ist seitdem dessen Betriebsteil Bardenberg. Die nächste Anschlussstelle ist "Broichweiden" auf der A 44. Die nächsten Bahnhöfe sind "Herzogenrath" und "Kohlscheid" an der Strecke Aachen - Geilenkirchen - Mönchengladbach. Busse des AVV verbinden Bardenberg mit Würselen, Morsbach, Pley, Niederbardenberg und Herzogenrath (Linie 21) sowie mit Kohlscheid (Linie HZ2) und Duffesheide (Linie 59). 867 wird Bardenberg erstmals urkundlich erwähnt. Der älteste Nachweis auf Bergbau stammt aus dem Jahre 1113. Vom 14. Jahrhundert bis zur Franzosenzeit gehört der Ort zum Herzogtum Jülich.
Von 1798 bis 1814 ist es eine Mairie im Kanton Eschweiler im französischen Département de la Roer und ab 1815 eine Gemeinde im Landkreis Aachen. Von 1808 an gehörte Bardenberg zum Bezirk des Friedensgerichts Eschweiler, später zum Amtsgerichtsbezirk Aachen. Aufgrund des Aachen-Gesetzes kommen am 1. Januar 1972 das Ortszentrum Bardenberg und der Ortsteil Pley an die neue Stadt Würselen, jedoch die Ortsteile Niederbardenberg und Wefelen an die neue Stadt Herzogenrath.
Duffesheide, welches auch zur Gemeinde Bardenberg gehörte, wird der Stadt Alsdorf zugeordnet. Durch die ehemalige Gemeinde Bardenberg verlaufen heute 3 Stadtgrenzen. In den letzten Jahren gehört Bardenberg mit den zwei Neubaugebieten Höfe-Viertel (Am Kuckhof, Am Stevenhof, Oststraße) und Schützenwiese (Hesselerstraße, Kelleterstraße, Knappschaftstraße, Kremerstraße, Nellessenstraße) zu den stark wachsenden Teilen von Würselen.
Broichweiden ist ein Stadtteil von Würselen im Kreis Aachen in Nordrhein-Westfalen. Sehenswert sind die Kirche St. Lucia und das Gut Klösterchen in der Nähe des Merzbachs. Von regionaler Bedeutung sind der Flugplatz Merzbrück und das Gewerbegebiet „Aachener Kreuz“. Broichweiden ist gut erschlossen durch die B 264 und die A 44 (Ausfahrt 5a „Broichweiden“). Wie im übrigen Würselener Stadtgebiet haben Jungenspiele in Broichweiden eine lange Tradition. Broichweiden wird das erste Mal um 1300 erwähnt. Von 1794 bis 1815 gehören die Gemeinden Broich und Weiden zum Kanton Eschweiler im Département de la Roer, ab 1816 zum neugebildeten Landkreis Aachen in Preußen. 1934 werden Broich und Weiden zu Broichweiden vereinigt. 1972 werden Bardenberg, Broichweiden und die Stadt Würselen zur neuen Stadt Würselen zusammengelegt. Broichweiden war zur kommunalen Neugliederung 1972 längstes Straßendorf Europas.
Die Keimzelle des alten Knappschaftskrankenhauses wurde am 1. April 1856 in einem früheren Gasthof im Ortskern Bardenbergs mit acht Betten, einem Pfleger und einer Haushälterin gegründet. Dieses Krankenhaus mitten im damaligen Aachener Steinkohlenrevier war damals eines der ersten urkundlich nachzuweisenden Knappschaftskrankenhäuser in der Geschichte des Steinkohlenbergbaus. Broichweiden gehörte viele Jahrhunderte zur evangelischen Kirchengemeinde Lürken und bildet heute zusammen mit dem benachbarten Hoengen die evangelische Kirchengemeinde „Hoengen-Broichweiden“. Das Broichweidener Wappen zeigt im oberen Teil den Jülicher Löwen und den Aachener Adler. Das Flugzeug im unteren Teil erinnert an den Flugplatz Merzbrück. Handball nimmt in Broichweiden eine prägende Rolle ein. Die beiden Vereine "DJK Westwacht 05 Weiden e.V." und "Weidener Turnverein 1869 e.V." spielen mit den Senioren- und Jugendmannschaften erfolgreich in den Ligen des Handball-Verband Mittelrhein. Des Weiteren ist der "Weidener Turnverein 1869 e.V." oder kurz "TV Weiden" Veranstalter der traditionellen "Internationalen Weidener Handballtage - Franz Otten Gedächtnisturnier", welches jedes Jahr im Sommer auf dem Broichweidener Sportplatz stattfindet. Euchen ist eine Ortschaft im westlichen Nordrhein-Westfalen und gehört seit 1972 zu Würselen im Kreis Aachen. Nachbarorte sind Würselen-Broichweiden und Alsdorf-Ofden. Euchen verfügt über einen Kindergarten, eine Kirche, einen kleinen Friedhof und einen Sportplatz am östlichen Ortsausgang. Am nördlichen Ortsausgang liegt eine Kläranlage., Patron der Pfarrkirche ist St. Willibrord. Von 1794 bis 1814 gehört Euchen zum Kanton Eschweiler im Département de la Roer, seit 1815 zum Landkreis Aachen im preußischen Rheinland. 1892 bietet der Kirchenvorstand von Euchen alte Kreuzwegstationen als Ölgemälde der Wallfahrtskirche St. Judas Thaddäus Thomasberg-Heisterbacherrott im heutigen Königswinter zum Geschenk. Bis zur Eingemeindung nach Alsdorf 1932 gehörte Kellersberg zur Pfarrei Euchen. 1973 gehören die „Jungenspiele Euchen“ zu den neun Gründungsmitgliedern der „Arbeitsgemeinschaft Würselener Jungenspiele e.V. (AWJ)“. Euchen liegt am Schnittpunkt zweier Landstraßen. In Richtung Westen liegen Birk und Bardenberg, in Richtung Norden Alsdorf, in Richtung Osten Broich, Linden-Neusen und St. Jöris sowie in Richtung Süden Broichweiden. Die nächste Anschlussstelle ist "Broichweiden" auf der A 44. Die nächsten Bahnhöfe sind "Herzogenrath" und "Kohlscheid" an der Strecke Aachen - Geilenkirchen - Mönchengladbach, "Eschweiler Hbf" an der Strecke Aachen - Düren - Köln sowie Alsdorf-Annaprk mit direktem Anschluss durch die Buslinie 31. AVV-Busse der Linie 31 und der Stadtbuslinie WÜ1 verbinden Euchen mit Würselen-Mitte, Würselen-Broichweiden, Würselen-Linden-Neusen, Alsdorf-Ofden und Alsdorf-Annaprk. Morsbach ist ein Stadtteil von Würselen im Kreis Aachen. Nachbarorte sind Würselen-Bardenberg und Würselen-Mitte. Patronin der katholischen Pfarre ist St. Balbina.
1599 wird die Morsbacher Steinkohlengrube „Gute Ley“ bzw. „Gouley“ im Aachener Revier erstmalig erwähnt. Anfang des 19. Jahrhunderts ist sie die ergiebigste Grube des Wurmreviers, und 1858 erwirbt sie der Eschweiler Bergwerksverein. 1969 wird sie stillgelegt. 1973 gehört das „Königsspiel Morsbach“ zu den neun Gründungsmitgliedern der „Arbeitsgemeinschaft Würselener Jungenspiele e.V. (AWJ)“. Die nächsten Anschlussstellen sind "Würselen" an der A 4 und "Broichweiden" an der A 44. Die nächsten Bahnhöfe sind "Kohlscheid" an der Strecke Aachen - Geilenkirchen - Mönchengladbach und "Eschweiler Hbf" an der Strecke Aachen - Düren - Köln. AVV-Busse der Linie 21 und der Stadtbuslinie WÜ1 verbinden Morsbach mit Würselen-Mitte, Würselen-Bardenberg, Würselen-Pley, Aachen, Herzogenrath-Niederbardenberg, Herzogenrath-Mitte und Herzogenrath-Kohlscheid. Oppen-Haal oder Haal-Oppen ist ein südlicher Stadtteil von Würselen im Kreis Aachen. Nördlich liegt Würselen-Mitte und östlich das Gewerbegebiet Kaninsberg am Aachener Kreuz. Südlich liegen der Kaninsberg und der Ravelsberg. 1449 wurde ein edler Adam von Hall-Frankenberg in seinem Haus belagert; dieses Haus Hall lag höchstwahrscheinlich in Haal. 1800 wurde unter französischer Herrschaft die Mairie de Wurselen im Kanton Burtscheid aus den bisherigen vier Bezirken Würselen, Scherberg, Schweilbach und Morsbach gebildet. Die Commune Würselen bestand zu diesem Zeitpunkt aus Drisch, Haal (oder: Hahl) und Oppen, die bis 1798 zum Quartier Weiden gehört hatten, sowie Würselen, Bissen, Elchenrath und Grevenberg. 1816 kommt Würselen und somit auch Oppen-Haal an den Kreis Aachen. Der heutige Doppelstadtteil liegt im Dreieck Haaler Straße/Oppener Straße/B 264. Die nächsten Anschlussstellen sind „Aachen-Zentrum/Würselen“ an der A 4 und „Würselen/Verlautenheide“ an der A 544. Der Brückenkopf im rheinischen Jülich ist eine Festungsanlage aus napoleonischer Zeit, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts errichtet wurde und die Stadt von Westen her schützen sollte. Er war in die Gesamtheit der Werke der Festung Jülich eingebunden. Der Brückenkopf ist als Kronwerk ausgelegt und weist eine Breite von etwa 800 Metern, eine Tiefe von etwa 300 Metern und eine Höhe von etwa zehn Metern auf. Er besteht im wesentlichen aus mit Mauern abgestütztem Erdreich. Auf dem Wall befinden sich tonnengewölbte Hohltraversen zur Aufstellung von Geschützen sowie für die Verteidigung mit Kleinwaffen, sie dienen auch der Abschnittsverteidigung, sollte ein Gegner einen Wallabschnitt erobert haben. Nach Westen hin wird die Breite des Brückenkopfes durch zwei Halbbastionen und eine Vollbastion gegliedert. Im Gegensatz zu den Bastionen der Zitadelle und der Stadtbefestigung aus dem 16. Jahrhundert, die sämtlich Vollbastionen (vollständig mit Erdreich gefüllt) sind, handelt es sich bei den Bastionen des Kronwerkes um leere Bastionen, die über keine Füllung verfügen. Die inoffiziellen Namen der Bastionen lauten: * Zoobastion, auch Bastion No. I * Bauhofbastion, auch Bastion No. III Der Name "Zoobastion" leitet sich von der jahrzehntelangen Nutzung des Vorgeländes als Vogelpark ab. In der "Bauhofbastion" befand sich lange Zeit das Lager für Baumaterial der Stadt Jülich. Vor der Escarpe des Brückenkopfes liegt ein breiter, wassergefüllter Graben. Hinter der Escarpe befindet sich eine durchgehende Galerie mit zahlreichen Scharten für die infanteristische Verteidigung. Dem Bauwerk waren mehrere Wassergräben und ein ausgedehntes Glacis vorgelagert. Der Brückenkopf schützte den strategisch wichtigen Übergang über die Rur und die dort installierte Schleusenbrücke, die neben dem Verkehr auch militärischen Zwecken diente. Durch die eingebauten Schleusentore konnte der Flusslauf gestaut und das ganze Gebiet südlich der Festung und um den Brückenkopf geflutet werden, um einem Angreifer die Annäherung zu erschweren. Nach der Stadtseite gab es einige leichte Befestigungen in Form einer 1,25 m starken und 2,5 m hohen und mit Schießscharten versehenen Mauer, um einer Umgehung bei Niedrigwasser vorzubeugen. Die der Rur zugewandten Mauern, deren Fundamente noch erhalten sind und die heute durch eine Hecke angedeutet werden, sind in bastionierter Form angelegt, um keine toten Winkel zu bieten. Als einziges freistehendes Gebäude findet sich auf dem Gelände der "Bauhofbastion" ein 1806 erbautes Kriegspulvermagazin ähnlich dem auf der Bastion St. Salvator der Zitadelle Jülich. Beide Magazine sind in ihrem Plan fast identisch, das in der Zitadelle ist jedoch um einiges größer. Wie sein größerer Bruder ist das Gebäude eines der ersten im metrischen System gebauten Bauwerke in der Stadt und besteht aus einem schweren Tonnengewölbe mit leichten vorgeblendeten Seitenwänden, die im Falle einer internen Explosion umfallen und so das Gewölbe vor der Zerstörung bewahren sollten.
Der Brückenkopf ist von großer bau- und kunsthistorischer Bedeutung, da er das einzige in Deutschland erhaltene Beispiel der Festungsbautechnik des französischen Empire zu Anfang des 19. Jahrhunderts ist. Nach schweren Kriegsschäden und jahrzehntelangem Verfall wurde das Gelände 1998 in die Landesgartenschau integriert. Der Brückenkopf wurde dabei einer umfangreichen, wenn auch nicht ganz vollständigen, Restaurierung unterzogen. Heute befindet sich dort der Brückenkopfpark Jülich. Der Festungspark wurde 2005 als herausragendes Beispiel in die Straße der Gartenkunst an Rhein und Maas aufgenommen. Der Rurübergang war bereits seit römischer Zeit von strategischer Bedeutung und ein Grund für die Entstehung der Stadt. Bereits in der Spätantike errichteten die Römer hier ein Kastell, das den Flussübergang und die Straßenstation in Jülich schützen sollte. Mit der Entstehung der Festung Jülich im 16. Jahrhundert wurde auch der Schutz der Rurbrücke wichtiger, da sie den einzigen Weg darstellte, auf dem man sich der Festung von Westen her nähern konnte.
Zugleich war sie nach wie vor ein wichtiges Straßenbauwerk auf dem Weg von Frankreich und Belgien zum Rhein. Bereits im 17. Jahrhundert zeigen Darstellungen der Stadt kleine Befestigungen am Kopf der Rurbrücke, die wohl auch während der Belagerungen Jülichs eine Rolle spielten, sich jedoch als kurzlebig erwiesen, vermutlich waren es einfache Erdwerke.
Erst die Franzosen, die 1794 in Jülich einrückten, legten ein größeres Gewicht auf einen Schutz des Rurübergangs. Sie planten eine große Erweiterung der Festung, die als wichtige Etappenfestung zwischen der Rheingrenze und dem französischen Mutterland dienen sollte, dabei war natürlich der Schutz des Flussübergangs und der Straße von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus sollte der feste Platz als Rückhalt für ein Bewegungsheer dienen, wobei selbstverständlich die Kontrolle des Flußübergangs überaus wichtig war - er ermöglichte den eigenen Truppen die schnelle Verlegung von einer Flußseite auf die andere und verwehrte dem Gegner diese Fähigkeit. 1799 wurde mit den Arbeiten am neuen Brückenkopf begonnen, die an dieser Stelle befindliche lutherische Kirche musste dem Neubau weichen. Kurz vor der geplanten Fertigstellung besuchte Kaiser Napoleon im Jahr 1804 die Baustelle und fand das Werk nicht besonders gelungen - es war überdimensioniert und wegen seiner Nähe zu den Höhen Richtung Aldenhoven auch verwundbar. Ein kleinerer Brückenkopf verbunden mit einem Fort auf der fraglichen Anhöhe hätte den Zweck besser erfüllt, aber für eine Umdisponierung war es wegen des erheblich fortgeschrittenen Baues zu spät. Man beschränkte sich darauf, die Südbastion (heute Bauhofbastion) mittels eines aufgeschütteten Oberwalls zu verstärken. Ein entsprechender Ausbau der anderen beiden Bastionen war ebenfalls vorgesehen, unterblieb aber aus Kostengründen. 1808 war das neue Festungswerk fertiggestellt. Seine einzige Bewährungsprobe erlebte der Brückenkopf während der Belagerung Jülichs 1814, jedoch kam es nur sporadisch zu Kampfhandlungen und das Werk blieb unbezwungen. Die Preußen übernahmen den Brückenkopf, als die Stadt 1815 an sie fiel, und hielten ihn bis zur Entfestigung Jülichs 1860 instand. Danach wurde die Anlage sich selbst überlassen und für andere Zwecke genutzt. Während des Deutsch-Französischen Krieges befand sich hier ein Kriegsgefangenenlager, und im Jahr 1893 wurde im Graben vor der heutigen Zoobastion ein Militärschwimmbad eingerichtet. 1911 wurde die alte Landstraße, die südlich um den Brückenkopf herumgeführt hatte, durch eine neue Straße ersetzt, die durch das Festungswerk hindurchführte, dabei musste ein Teil der Kurtine weichen. 1929 wurde der Brückenkopf in einen Volkspark umgewandelt, und bereits 1934 erfolgte der Umbau zur nationalsozialistischen Thingstätte, von der einige Teile erhalten blieben, so z.B. die Fundamente der ehemaligen Bühne zwischen Mittel- und Zoobastion bis zur Oberflache des Grabens. Eine rheinische Firma nutzte die umfangreichen Kasematten zur Champignonzucht. Im Zweiten Weltkrieg war der Brückenkopf Ende 1944 und Anfang 1945 Schauplatz erbitterter Kämpfe zwischen deutschen und amerikanischen Verbänden und wurde dabei schwer beschädigt. In einem Gewölbe des Brückenkopfes waren während des Krieges wertvolle Bestände des Jülicher Stadtarchivs und Heimatmuseums ausgelagert, ausgerechnet dieses Gewölbe wurde durch einen unglücklichen Bombenvolltreffer zerstört und mit ihm die Dokumente und Artefakte. Nach dem Ende der Kampfhandlungen dienten die umfangreichen Kasematten Flüchtlingen als Unterschlupf. In der Nachkriegszeit verfielen die Festungsanlagen und wurden von Bäumen und Unterholz überwuchert, der Waffenplatz im Innern wurde als Kirmesplatz und als Standort einer Reithalle genutzt, in der Südbastion fand der Maschinenpark des Städtischen Bauhofs seinen Platz. Auch ein Gasthaus siedelte sich entlang der Straße an, das 2006 endgültig abgerissen wurde. Ab den 1970er Jahren dienten Teile der Wallanlagen als Gehege für den Brückenkopfzoo, ab den 1980er Jahren begannen erste Restaurierungsarbeiten. Im Vorfeld der Landesgartenschau 1998 wurden etwa 90% des Brückenkopfes restauriert und das Innere sowie das Glacis zu einem großen Park mit umfangreichen Gartenanlagen umgewandelt. Unrestauriert blieben bislang lediglich die Facen der Mittelbastion. Der Brückenkopf dient heute in Form des Brückenkopfparks als Naherholungsgebiet und Veranstaltungsort. Eine Knappschaft (auch Bergknappschaft) ist ein organisatorischer Zusammenschluss der in einem Bergwerk oder in einem Revier beschäftigten Bergleute mit dem Ziel der Arbeitnehmerinteressenvertretung (ähnlich einer Gewerkschaft) und der gegenseitigen sozialen Absicherung (ähnlich einer Genossenschaft).
Knappschaften bildeten anfangs privilegierte Korporationen unter gewählten Ältesten (Knappschaftsältesten) und Vorstehern, waren befreit vom Soldatendienst, von persönlichen Steuern, genossen einen gefreiten Gerichtsstand etc. Diese Vorrechte sind ebenso wie die ihnen entsprechenden Beschränkungen der Knappschaft heute beseitigt; dagegen haben sich die überlieferten Gebräuche der Knappschaft, die Abzeichen (Schlägel und Eisen), der Bergmannsgruß (Glück auf!), die eigentümliche Tracht bei festlichen Aufzügen etc. noch erhalten. Im Jahr 2010 begeht die Knappschaft ihr 750-jähriges Jubiläum. Eine Urkunde aus dem Jahr 1260 vom Rammelsberg bei Goslar – datiert auf den 28. Dezember 1260 – belegt die erste Bergbruderschaft und gibt damit den ersten Hinweis auf die Sozialfürsorge für Bergleute. Damit ist die Knappschaft – inzwischen in moderner Unternehmensstruktur als Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See – die weltweit älteste Sozialversicherung. Dieses Urkunden-Datum ist mehr als nur der Ursprung der Knappschaft als Institution berufsständischer Sozialfürsorge. Mit diesem Datum verbindet sich auch der Ursprung der deutschen und europäischen Sozialversicherung überhaupt. Die Knappschaft hat seither in vielen Bereichen der sozialen und gesundheitlichen Absicherung als sozialer Pfadfinder gewirkt. Im Knappschaftswesen haben zahlreiche Errungenschaften der sozialen Sicherung und Krankheitsfürsorge in Deutschland ihren Ursprung. So gehören zur Geschichte der Knappschaft die Geburtsstunden von Rentenversicherung, Krankenversicherung und Hinterbliebenenversorgung, die Sozialversicherungspflicht, die Begründung der Selbstverwaltung, die gemeinsame Beitragszahlung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, die erste Rentenformel und der erste Ärztekollektiv-Vertrag – vieles davon lange vor Bismarck und der kaiserlichen Sozialgesetzgebung von 1881.
Seit fast 180 Jahren betreibt die Knappschaft moderne Knappschaftskrankenhäuser und seit mehr 110 Jahren Reha-Kliniken. Das alles sind Meilensteine auf dem Weg der Entwicklung unseres heutigen modernen Sozialstaates. Die Knappschaft hat in ihrer Geschichte bis heute zahlreiche bedeutende Beiträge zur Entwicklung des Sozialsystems in Deutschland und auch darüber hinaus geleistet. Sie ist das Musterbeispiel gesellschaftlicher Notwendigkeit für institutionelle soziale Absicherung. Im Jubiläumsjahr 2010 werden die Leistungen der Knappschaft als Ursprung unseres heutigen sozialen Systems in vielfältiger Weise gewürdigt. So soll beispielsweise am 1. Juli 2010 eine Jubiläums-Ausstellung im Deutschen Bergbau-Museum Bochum eröffnet und am 11. November 2010 eine Sonderbriefmarke „750 Jahre Knappschaft“ herausgegeben werden. Zur gegenseitigen Unterstützung, insbesondere gegen die Gefahren des Berufs, wurden bereits seit alter Zeit eigene Knappschaftskassen (Bruderladen, so besonders in Österreich genannt, Gnadengroschenkassen) gebildet, deren bereits die Kuttenberger Bergordnung von 1300 gedenkt. Ursprünglich war ihre Bildung der freien Vereinigung der Beteiligten (Knappschaftsvereine) überlassen. Die Gesetzgebung (Preußen seit 1854, Österreich 1854, bez. 1892) hat die Bildung solcher Kassen allgemein (in Sachsen nur für Erzbergbau) vorgeschrieben. Alle Arbeiter müssen beitreten. Neben ihnen sind auch die Werksbesitzer an den Kosten und der Verwaltung beteiligt. Diese haben wenigstens die Hälfte der von den Arbeitern gezahlten Beiträge zuzuschießen. Die Verwaltung erfolgt durch einen von den Werksbesitzern und Arbeitern je zur Hälfte gewählten Vorstand unter der Aufsicht der Bergbehörde. [...] Die Kassen, welche bestimmte Bezirke zu umfassen haben, gewähren [...] für vollberechtigte Mitglieder in Krankheitsfällen freie Kur und Verpflegung, Krankenlohn, Beitrag zu den Begräbniskosten, Invaliden- sowie Witwen- und Waisenpension. Die Höhe der Pension wächst mit der Dauer der Mitgliedschaft, die der Unterstützungen und Beiträge wird durch Statut festgestellt. [...] Für das ganze Deutsche Reich ist zur Entschädigung aller Betriebsunfälle eine Knappschafts-Berufsgenossenschaft gebildet worden. Die Knappschaftsmitglieder genügen, sofern die Knappschaftskasse gewissen gesetzlich festgestellten Voraussetzungen entspricht, auch ihrer Alters- und Invaliditätsversicherungspflicht durch Beteiligung an dieser Kasse. Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Würselen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia. Dem Artikel Burg Wilhelmstein aus der freien Enzyklopädie Wikipedia. Dem Artikel Grube Gouley aus der freien Enzyklopädie Wikipedia. Dem Artikel Bardenberg aus der freien Enzyklopädie Wikipedia. Dem Artikel Broichweiden aus der freien Enzyklopädie Wikipedia. Dem Artikel Euchen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia. Dem Artikel Morsbach (Würselen) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia. Dem Artikel Oppen-Haal aus der freien Enzyklopädie Wikipedia. Dem Artikel Brückenkopf Jülich aus der freien Enzyklopädie Wikipedia. Dem Artikel Knappschaft aus der freien Enzyklopädie Wikipedia. |